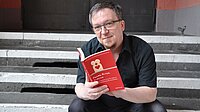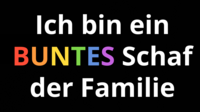Definitionen nach 100% Mensch
Die queere Szene ist reich an Abkürzungen. Wir haben euch angelehnt an das Lexikon von 100% Menschen einige rausgesucht. Das ganze Lexikon findet ihr hier.
Asexuell (ACE)
Als asexuell (ace) werden Menschen bezeichnet, die keine sexuelle Anziehung gegenüber anderen Personen verspüren.
Sexuelles Verlangen kann jedoch vorhanden sein (Selbstbefriedigung). Auch körperlicher Kontakt (z.B. Kuscheln, Küsse) ist nicht ausgeschlossen, hat jedoch keine sexuelle Bedeutung.
Asexuelle müssen nicht automatisch aromantisch sein, d.h. sie können sehr wohl in einer romantischen Beziehung leben, allerdings ohne sexuelles Verlangen.
Neben der Schreibweise „asexuell“ wird manchmal auch die Schreibweise „a_sexuell“ genutzt um zu zeigen, dass A_sexualität ein Spektrum mit vielen verschiedenen Abstufungen ist (gray-as / grey-ace).
Kurz: Asexuelle haben kein Verlangen nach Sex mit anderen Menschen.
Allosexualität
Allosexuell beschreibt häufig Personen, die sich sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Somit handelt es sich um das Gegenteil von „asexuell“. Der Begriff ermöglicht es, diskriminierungsfrei über asexuelle und allosexuelle Menschen zu sprechen. Jedoch kann allosexuell auch als eine Fremdzuweisung verstanden werden, denn der Begriff wurde innerhalb der asexuellen Community entwickelt und ist somit keine selbstgewählte Bezeichnung von allosexuellen Menschen. Dennoch ist er wichtig, um wertfrei und begrifflich abgrenzen zu können, ohne asexuell als Abweichung von einer Norm darzustellen.
Alley, Advocate, Activist
Ally heißt auf deutsch Unterstützer*in. Im Allgemeinen wird der Begriff Ally für Menschen benutzt, die Teil einer Mehrheit sind und eine unterdrückte Gruppe unterstützen. Im Kontext der LGBTIQ*-Community sind Allies Menschen, welche die Community unterstützen, obwohl sie selbst nicht queer sind.
Advocate bedeutet auf deutsch Fürsprecher*in. Ein*e Fürsprecher*in ist eine Person, die für eine bestimmte Gruppe spricht und über Themen informiert, die diese Gruppe betreffen. Im Falle der LGBTIQ*-Communtiy handelt es sich bei Fürsprecher*innen sowohl um queere Menschen, als um auch nicht-queere Personen, die sich öffentlich für die Community aussprechen.
Activist heißt auf deutsch Aktivist*in. Dabei handelt es sich um Menschen, die sich politisch engagieren und sich aktiv für die Rechte von diskriminierten Gruppen einsetzen. Im Kontext der LGBTIQ* Community geht es dabei um die Rechte von queeren Menschen. Aktivist*innen arbeiten daran, Veränderungen zu bewirken. Um ein*e Aktivist*in zu sein, bedarf es Handlungen – es reicht nicht aus, sich nur für ein Thema auszusprechen.
Aromatik
Als aromantisch (ARO) bezeichnen sich Menschen, die keine oder nur wenig romantische Anziehung gegenüber anderen Personen verspüren. Romantische Liebe hat für sie keinen besonderen Stellenwert. Aromantisch (auch nonromantisch) heißt nicht zwangsläufiug auch asexuell zu sein. Häufig stoßen aromantische Menschen auf Unverständnis und werden gefragt, ob ihnen denn romantische Beziehungen mit anderen Menschen nicht fehlen würde. Nein, denn wo kein Verlangen vorhanden ist, entsteht auch kein Gefühl des Fehlens.
Manchmal sieht man auch die Schreibweise A_romantisch. Diese soll verdeutlichen, dass A_romatik viele Schattierungen aufweist.
Beziehungen
Monoamourös
beschreibt einen Menschen, der seine romantische Aufmerksamkeit nur auf eine Person zur selben Zeit richtet.
Offen-monoamourös
bezieht sich auf romantische Paarbeziehungen, die in Absprache unter den Partner*innen auch sexuelle Kontakte außerhalb der Partnerschaft enthalten können
Polyamourös
bezeichnet eine Person, die ihre romantische Aufmerksamkeit auf mehr als eine Person zur selben Zeit richten kann. Konstellationen, in denen mehrere Personen ausschließlich innerhalb der Beziehungsgruppe sexuelle Kontakte pflegen, können als geschlossen-polyamourös bezeichnet werden.
offen-polyamourös
werden romantische Liebesbeziehungen zwischen mehreren Menschen, bei der die Partner*innen auch sexuelle Kontakte außerhalb der Beziehungsgruppe haben können, genannt.
Monogamie
wird häufig sinngleich mit „monoamourös“ verwendet, bezieht sich jedoch ursprünglich auf die sexuelle und amouröse Treue in der Ehe. Polygamie bedeutet eine Vielehe, bei der mehr als nur zwei Menschen miteinander verheiratet sind. In Deutschland ist Polygamie gesetzlich verboten.
Bi(+)Sexualität
Der Begriff der Bisexualität wird gerade stark diskutiert – daher folgen zwei Erklärungen:
1. Binäre Deutung: Bisexuelle Menschen fühlen sich sexuell sowohl zu Frauen als auch zu Männern hingezogen. Bisexualität ist eine feste Orientierung und ist unabhängig von der*dem aktuellen Partner*in. Also bleibt eine bisexuelle Frau auch dann bisexuell, wenn sie sich gerade in einer sexuellen Beziehung mit einem Mann befindet.
2. Bi+sexualität soll verdeutlichen, dass sich auch Menschen als bisexuell bezeichnen, die zwei oder mehr Geschlechter sexuell anziehend finden (polysexuell). Somit würde diese Neubestimmung des Begriffs auch ein deutlicheres Aufbrechen des binären Geschlechterkonstruktes beinhalten. Die Abgrenzung gegenüber Pansexualität besteht weiter – in der Attraktion durch das Geschlecht, während bei pansexuellen Menschen das Geschlecht an sich nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Binäre Geschlechter
Unsere westliche Gesellschaft geht überwiegend davon aus, dass Geschlecht ein binäres System ist. Binär steht für „zweiteilig“ und reduziert auf nur zwei Geschlechter: männlich und weiblich. Sämtliche anderen Geschlechter werden als Abweichung von der (binären) Norm betrachtet und unterdrückt.
Dieses strikt zweigeteilte System ist ein religiös geprägtes Konstrukt, das gesellschaftliche Erwartungen an „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ aufbaut. Aus diesen Erwartungen entstehen klare Geschlechterrollen, deren Nichteinhaltung negative Konsequenzen wie Anfeindungen mit sich bringt.
Langsam entwickelt sich das binäre Verständnis von Geschlecht hin zu einem offenen Geschlechtersystem. Dieses sieht Geschlecht als ein Spektrum mit vielen verschiedenen Geschlechtern und unzählige Abstufungen zwischen „männlich“ und „weiblich“. Ein offenes System wirkt Unterdrückung und Ausgrenzung entgegen, indem es Geschlecht in seiner Vielfalt erfasst und keine Normen aufbaut.
Cisnormativität
Die cisnormative Weltanschauung basiert auf mehreren Fehlannahmen:
- Es gibt nur zwei Geschlechter (männlich und weiblich).
- Das Geschlecht einer Person lässt sich anhand ihrer Genitalien bestimmen.
- Bei allen Menschen stimmt grundsätzlich ihr Geschlecht(sbewusstsein) mit ihren Genitalien und damit auch mit dem ihnen nach der Geburt zugewiesenen Geschlecht überein. Das bedeutet, alle Menschen sind cis.
Cisnormativität stellt Cisgeschlechtlichkeit als Norm und trans* bzw. Intergeschlechtlichkeit als Abweichung dar. Die Charakterisierung von trans* und inter als „anders“ oder „unnormal“ führt zu Diskriminierung und Ausgrenzung innerhalb der Gesellschaft.
Bevor ein Mensch überhaupt geboren wird, steht bereits die Frage im Raum, ob es sich bei ihm um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Dabei gibt es mehr als nur zwei Geschlechter. Genaugenommen ist die Frage vielmehr eine Frage nach den Genitalien des Kindes.
Über das eigene Geschlecht kann nur eine Person selbst Auskunft geben. Bei der Bestimmung des Geschlechts anhand der Genitalien handelt es sich stets um eine Fremdzuweisung. Cissexismus beschreibt die Marginalisierung und Unterdrückung von trans*, nicht-binären und intergeschlechtlichen Menschen auf übergeordneter, institutioneller, gesellschafftlicher, rechtlicher und kultureller Ebene. Er ist Teil eines strukturellen Systems der Unterdrückung, wie beispielsweise Rassismus oder Sexismus.
Transfeindlichkeit und Cissexismus sind eng verknüpft, wobei sich Transfeindlichkeit mehr auf die Unterdrückung und Anfeindung auf individueller Ebene (durch Einzelpersonen und Gruppen) bezieht.
Coming-Out
Der Begriff Coming-Out (deutsch: „Herauskommen“) bezeichnet die Selbstoffenbarung der eigenen Orientierung oder des Geschlechts. Oft wird er in Zusammenhang mit dem Ausdruck „Coming out of the closet“ gebracht, wörtlich „den Schrank verlassen“. Diese Redensart tauchte jedoch erst in den 1960ern auf, nachdem Coming-Out bereits Einzug in den Sprachgebrauch der LSBTTIQ* Community gehalten hatte.
Anfangs verwendeten ausschließlich schwule Männer den Begriff Coming-Out. Sie bezeichneten damit die Offenbarung ihrer sexuellen Orientierung vor anderen schwulen Männern und ihren Beitritt in die schwule Community. Die heutige Verwendung von Coming-Out kann unter anderem auf den deutschen Juristen und Aktivisten für Schwulenrechte Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) zurückgeführt werden. Er sah in der Selbstoffenbarung einen Weg zur Emanzipation. Ulrichs betrachtete es als notwendig, dass homosexuelle Menschen ihre sexuelle Orientierung mit Selbstbewusstsein präsentierten. Nur so könnte die öffentliche Einstellung zu homosexuellen Menschen geändert werden. Ein Coming-Out ist noch immer notwendig, da unsere heteronormative und cissexistische Gesellschaft annimmt, man sei heterosexuell und cisgeschlechtlich – bis man dieser Annahme widerspricht.
Ein Coming-Out ist häufig mit Angst vor sozialer Ausgrenzung und anderen negativen Konsequenzen besetzt. Hinzu kommt oft die Sorge, sozialen Erwartungen nicht zu entsprechen. Gleichzeitig ist ein Coming-Out für die meisten Personen sehr befreiend, weil sie ihr wahres Ich offenbaren und endlich sichtbar sein können.
Es gibt zwei Arten von Coming-Outs: Wenn sich eine Person ihre sexuelle Orientierung/ihr Geschlecht selbst eingesteht, spricht man vom inneren Coming-Out. Teilt die Person diese Erkenntnisse mit anderen, wird das als äußeres Coming-Out bezeichnet. Das Coming-Out ist ein Dauerprozess. Die meisten Menschen outen sich nicht nur einmal, sondern immer wieder, wenn sie beispielsweise neue Leute kennenlernen oder sich in einem neuen sozialen Umfeld bewegen.
Ein Coming-Out muss nicht vollständig sein. Jede Person kann selbst entscheiden, wem sie ihre sexuelle Orientierung oder ihr Geschlecht offenbart. Der Begriff Outing beschreibt hingegen die übergriffige Handlung, bei der eine Person ungefragt die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Thematik eines anderen Menschen offenbart.
Drag / Travestie
„Travestie“ (von französisch travesti „verkleidet“) ist eine Kunstform, in der sich zunächst Männer als Frauen verkleideten. Charakteristisch für diese Kunstform ist die Überzeichnung von Stereotypen und Geschlechterklischees.
Woher der Begriff „Drag“ genau kommt, ist nicht abschließend geklärt. Eine Hypothese ist, dass sich die Begrifflichkeit „Drag“ auf Shakespeare zurückführen lässt. Shakespeare verwendete in seinen Theaterstücken die Phrase „dressed as girl“ (= „gekleidet wie ein Mädchen“, kurz: drag) um männliche Darsteller darauf aufmerksam zu machen, dass sie in diesen Rollen als „Frau“ gekleidet auf der Bühne erscheinen sollten.
Drag spielt im Gegensatz zu Travestie nicht nur mit Geschlechterklischees, sondern geht darüber hinaus und kann mit dem Konzept von Geschlecht an sich brechen. Es gibt Drag Kings und Drag Queens, wobei Drag Queens „Frauen“ überzeichnet darstellen und Drag Kings „Männer“.
Bekannte Beispiele für Drag Queens sind unter anderem Conchita Wurst, RuPaul oder Mary Morgan und Gordy Blanche. Bekannte Beispiele für Drag Kings sind unter anderem Spikey van Dykey, Landon Cider oder Elvis Herselvis. Travestie und Drag sind als Kunstformen klar abzugrenzen von Trans*. Sie stellen reine Bühnentechniken also Kunstformen dar und sind unabhängig vom eigenen Geschlechtsbewusstsein. Ebenso sind Travestie und Drag nicht an eine sexuelle Orientierung gebunden – ja, es gibt auch heterosexuelle Drag Queens.
Dritte Option
Neben den zwei Geschlechtsoptionen „männlich“ und „weiblich“ besteht seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 die Möglichkeit, das Geschlecht als „divers“ eintragen zu lassen. Diese dritte Option soll intergeschlechtlichen Personen einen positiven Geschlechtseintrag ermöglichen.
Der Geschlechtseintrag „divers“ kann ausschließlich von intergeschlechtlichen Personen in Anspruch genommen werden, die sich einer Begutachtung durch Mediziner*innen unterziehen. Das bedeutet, intergeschlechtliche Menschen können weiterhin ihren Geschlechtseintrag nicht selbst bestimmen. Sie sind von einer Fremdzuweisung durch Mediziner*innen abhängig.
Bei der momentanen Gesetzeslage zum Dritten Geschlechtseintrag handelt es sich um eine absolute Minimallösung. Das Thema muss dringend weiterbearbeitet werden, um die Fremdzuweisung durch Mediziner*innen zu stoppen und intergeschlechtlichen Personen Selbstbestimmung zu ermöglichen. Außerdem sollte der Geschlechtseintrag „divers“ auch nicht-binären Menschen zur Verfügung stehen.
ACHTUNG: Die Dritte Option ist ausschließlich eine Eintragsoption im Personenstand und KEIN drittes Geschlecht!
Genderfluid
Genderfluide Menschen haben ein „flüssiges“ Geschlecht, welches sich mit der Zeit oder in Abhängigkeit von Situationen ändert. Obwohl „genderfluid“ ein nicht-binäres Geschlecht ist, können sich genderfluide Personen auch zeitweise binär (männlich/weiblich) verorten.
Heteronormativität
Unsere Gesellschaft ist stark heteronormativ geprägt. Eine heteronormative Weltanschauung stellt Heterosexualität als soziale Norm und einzige „normale“ sexuelle Orientierung dar.
Grundsätzlich gelten Menschen als heterosexuell und cisgeschlechtlich, bis sie sich als nicht-heterosexuell und/oder nicht-cisgeschlechtlich outen. Dieses Coming-Out ist in einer heteronormativen Gesellschaft notwendig, um die eigene Orientierung und/oder das eigene Geschlechtsbewusstsein sichtbar zu machen. Allerdings ist ein Coming-Out in diesem Rahmen häufig mit Angst vor sozialen Konsequenzen und der Sorge verbunden, der gesellschaftlichen Erwartungshaltung nicht zu entsprechen.
Eine gravierende Folge dieser Heteronormativität ist LSBTTIQ*-Feindlichkeit. Queere Menschen werden von einer heteronormativen Gesellschaft oft marginalisiert, diskriminiert und verfolgt. Ihre sexuellen Orientierungen gelten als Abweichungen von der Norm. Außerdem leiden viele (nicht-binäre) trans* bzw. intergeschlechtliche Menschen stark unter der heteronormativen Unterteilung in nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Diese binäre Einteilung ist notwendig, um Heterosexualität überhaupt eine Aussagekraft zu verleihen. Denn gibt es mehr als zwei Geschlechter, verliert Heterosexualität (=sexuelle Anziehung zum „anderen“ Geschlecht) seine Aussagekraft.
Die Geschlechter werden anhand der Genitalien nach der Geburt zugewiesen. Heteronormativität basiert auf der Annahme, dass sich aus dem nach der Geburt zugewiesenen Geschlecht das Geschlechtsbewusstsein und die sexuelle Orientierung einer Person ableiten lassen. Personen, denen nach der Geburt „männlich“ zugewiesenen wurde, haben auch ein „männliches“ Geschlechtsbewusstsein und fühlen sich ausschließlich zu weiblichen Personen hingezogen – und umgekehrt.
Zusätzlich hält Heteronormativität an traditionellen Geschlechterrollen fest. Das bedeutet, es gibt klare Vorstellungen, wie sich Frauen und Männer verhalten sollten. „Feminin“ wäre es nach dieser Auffassung beispielsweise, ein Kleid oder Make-Up zu tragen sowie sehr fürsorglich zu sein. Dieses Verhalten ist allerdings nur für Frauen sozial akzeptabel. Typisch „maskulin“ wäre es hingegen, keine Emotionen zu zeigen, einen Bart zu tragen oder dominant zu sein.
Heteronormativität schadet nicht nur queeren Menschen. Traditionelle, heteronormative Geschlechterrollen schränken alle ein. Sie schreiben vor, wie sich Menschen entsprechend ihrer Geschlechter zu verhalten haben und lassen wenig Spielraum, die eigene Persönlichkeit frei auszuleben.
Intergeschlechtlichkeit
Lässt sich ein Mensch anhand seiner körperlichen Merkmale (insbesondere der Genitalien), der Chromosomen oder der Hormonproduktion nicht eindeutig der medizinischen-gesellschaftlichen Norm von „männlich“ oder „weiblich“ zuordnen, sind seine körperlichen Merkmale also (aus mehrheitsgesellschaftlicher Sicht) mehr- oder uneindeutig, wird von Intergeschlechtlichkeit oder Inter* gesprochen.
Noch heute werden in Deutschland etwa 1.700 genitalzwangszuweisende Operationen pro Jahr an inter* Menschen im Kleinstkindsalter durchgeführt, obwohl es sich hierbei um eine klare Menschenrechtsverletzung handelt. Bei diesen Eingriffen werden die Genitalien von inter* Menschen in der Regel gewaltsam an ein „weibliches“ Genital angeglichen.
Da hier nicht das Kind im Mittelpunkt steht, sondern die gesellschaftliche Erwartungshaltung, werden diese Eingriffe auch „normierende“ Operationen genannt.
Seit Anfang 2019 können intergeschlechtliche Personen ihren Personenstand als „divers“ (Die Dritte Option) eintragen lassen. Hierfür ist aber derzeit noch immer eine übergriffige Begutachtung durch Mediziner*innen, also eine fremdbestimmte Diagnose notwendig.
Der Begriff inter* umfasst als Überbegriff Selbstbezeichnungen wie intersex, intergender, intersexuell oder intergeschlechtlich.
LGBTTIQQAAP*
In den USA der 1980er entstand die Abkürzung LGB (lesbian, gay, bisexual) als Ersatz für das zu dieser Zeit negativ konnotierte Wort „homosexual“ (homosexuell). In den 1990ern kam ein T für „transgender“ hinzu. Später wurde das Akronym um ein I für „intersex“ (intergeschlechtlich) und ein q für queer („keine Schublade“) bzw. questioning (fragend) erweitert. Die Abkürzungen LGBTQ und LGBTIQ sind als Oberbegriff für queere Menschen weltweit verbreitet. Im deutschen Sprachgebrauch werden oft LSBTI, LSBTIQ und LSBTTIQ verwendet. Das S steht dabei für schwul und das zweite T für transsexuell. Ein hinzugefügtes Sternchen (*) soll all diejenigen Menschen in der Community einschließen, die sich selbst weder als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intergeschlechtlich oder queer bezeichnen, dennoch nicht heterosexuell und/oder cisgeschlechtlich sind oder sich aus anderen Gründen der Community zugehörig fühlen.
Gelegentlich werden dem Begriff LSBTTIQ* einige Buchstaben hinzugefügt, um keine Gruppe auszuschließen. Das längste derzeit verwendete Akronym ist LGBATIQQP+. Es steht für lesbisch, schwul (gay), bisexuell, asexuell, trans*, inter*, queer, questioning und pansexuell. Das Plus erfüllt den gleichen Zweck wie das Sternchen bei LSBTTIQ*.
Die Abkürzung LSBTTIQ* bezeichnet häufig eine ganze Community. Allerdings benennt sie nur einzelne Gruppen innerhalb der Gemeinschaft und nicht alle. Außerdem kritisieren einige Menschen die Abkürzung als zu sperrig. Um diesen Problemen zu entgehen, wird auch von der queeren Community oder der Regenbogen-Community / Regenbogen-Gemeinschaft gesprochen. Diese Begriffe werden jedoch ebenfalls kritisiert, denn sie könnten durch ihre Allgemeinheit einzelne Gruppen in der Community unsichtbar machen. Wir können gespannt sein, wie sich die Begrifflichkeiten im Laufe der Zeit weiter verändern werden.
nicht-binär
Die christlichen Kulturen teilen die Menschen in gerade mal zwei Geschlechter ein: weiblich und männlich. Mittlerweile wurde mit „inter/divers“ in Deutschland immerhin ein Personenstand für intersex Personen geschaffen – und so zumindest dieses Geschlecht rechtlich anerkannt (Die Dritte Option).
Jedoch gibt es noch sehr viel mehr Geschlechter: Andere Kulturen wie z.B. in Thailand und Bolivien, die indigenen Völker Nordamerikas, aber auch die jüdischen Schriften (z.B. Androgynos, Ay’lonit, Saris, Tumtum) kennen bis zu zehn verschiedene Geschlechter.
Menschen, die sich dem hier überwiegenden Zweiersystem nicht zugehörig fühlen, sondern ihr Geschlecht außerhalb dieses Systems wissen oder auch mehreren Geschlechtern gleichzeitig angehören, werden als Nicht-Binäre bzw. non-binarys (Enby) bezeichnet. Sie sind also nicht (ausschließlich) männlich und auch nicht (ausschließlich) weiblich.
Ähnlich wie Menschen mit Transexus leiden auch nicht-binäre Personen häufig unter dem Widerspruch zwischen Körpermerkmalen und Geschlecht (Körperdysphorie) bzw. erwarteter sozialer Rolle und Geschlecht (Genderdysphorie).
„Nicht-binär“ ist ein Überbegriff für sehr viele unterschiedliche Geschlechter: agender, neutrois, androgyn, mixed-gender, genderfluid, bigender, genderqueer, demi-boys, demi-girls und viele mehr. Da man Menschen nicht unbedingt ansieht, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen und welches Personalpronomen sie bevorzugen – fragt einfach nach. Oder: Stellt Euch doch einfach mal mit Personalpronomen vor: „Hallo ich bin Josh, mein Personalpronomen ist er/ihn„. Das sorgt zunächst für Verwirrung, macht aber auch deutlich, dass Euch das Thema wichtig ist.
Pansexualität
Für pansexuelle Menschen spielt das Geschlecht einer Person keine Rolle. Sexualität kann mit allen Menschen unabhängig von deren Geschlecht gelebt werden. Dieses Zurücktreten des Geschlechts unterscheidet Pansexualität von Bi+sexualität und anderen polysexuellen (auf mehr als ein Geschlecht bezogenen) Orientierungen, da bei diesen zwar mehrere oder alle Geschlechter als sexuelle anziehend empfunden werden, dem Geschlecht jedoch keine Bedeutung zukommt.
Queer
Queer bedeutet so viel wie „keine Schublade“ und steht für die Abweichung von der heterosexuellen und cisgeschlechtlichen gesellschaftlichen Norm.
Im Englischen galt queer lange Zeit als homofeindliches Schimpfwort. Indem sich homosexuelle Menschen selbst als queer bezeichneten, verlor es jedoch mehr und mehr seine negative Bedeutung (= „Reclaiming„). Heute sieht ein Großteil der LSBTTIQ* Community den Begriff als zurückerobert an. Allerdings gibt es noch immer Menschen, welche den Begriff queer aufgrund seiner Geschichte ablehnen.
Als Sammelbegriff umfasst queer alle Untergruppen der LSBTTIQ* Community, ohne einzelne hervorzuheben, auszuschließen oder zu labeln. Diese Verwendung von queer wird jedoch teilweise kritisiert, denn die Sichtbarkeit einzelner Gruppen innerhalb der Community könnte dadurch abnehmen.
Als Selbstbezeichnung wird queer häufig von Menschen verwendet, die ihr Geschlecht oder ihre Orientierung keiner bestimmten Kategorie zuordnen wollen.
Außerdem gibt es eine interdisziplinäre kulturwissenschaftliche Forschungsrichtung, die sich „Queer Studies“ nennt. Dieser Wissenschaftszweig befasst sich mit Sexualität, sexueller Orientierung und Geschlecht und legt dabei einen Fokus auf LSBTTIQ* Themen.
Regenbogenflagge
Die Regenbogenflagge steht weltweit für Aufbruch, Veränderung, Frieden, Hoffnung und Akzeptanz. Seit den späten 1970ern gilt sie auch als internationales Zeichen der LSBTTIQ* Community und symbolisiert „Pride“ (deutsch: Stolz), sowie die Vielfalt der queeren Community.
Die Pride-Regenbogenflagge wurde 1978 vom amerikanischen Künstler Gilbert Baker für den Gay Freedom Day entworfen, dem Vorläufer der späteren Gay Pride. Die ursprüngliche Version von Bakers Flagge hat acht Farbstreifen, die unterschiedliche Bedeutungen haben:
Hot Pink = Sexualität,
Rot = Leben,
Orange = Gesundheit,
Gelb = Sonnenlicht,
Grün = Natur,
Türkis = Kunst,
Königsblau = Harmonie,
Violett = Geist.
Gilbert Baker färbte die ersten Pride-Flaggen von Hand. Als die Flagge jedoch maschinell hergestellt werden sollte, musste sie auf sieben Streifen reduziert werden – denn „Hot Pink“ ließ sich zu diesem Zeitpunkt nicht industriell färben. Der türkisene Streifen wurde 1979 entfernt, um eine gerade Anzahl an Streifen zu erhalten. Inzwischen wird versucht, die Regenbogenflagge wieder in ihren ursprünglichen acht Farben zu etablieren. In Deutschland wurde die Regenbogenflagge erstmals 1996 an einem öffentlichen Gebäude in Berlin gehisst. Seit 2015 ist die Pride-Regenbogenflagge fester Bestandteil der Design-Ausstellung im Museum of Modern Art in New York.
trans*
Trans* wird international (dann jedoch ohne Sternchen) von vielen Menschen als Sammelbegriff für alle Formen von Transsexus, Transsexualität, Transidentität, Transgeschlechtlichkeit und Non-Binary verwendet. Der Begriff wird von und für Menschen verwendet, die sich mit dem nach der Geburt anhand der Genitalien zugewiesen Geschlecht nicht oder nicht ausreichend beschrieben wissen.
Das Sternchen verdeutlicht die Diversität der Gruppen, die sich unter dem Begriff trans* versammeln und ist dementsprechend inkludierend und nicht vereinnahmend gemeint.
Transgender
Der Oberbegriff „transgender“ wird von Menschen genutzt, welche die herkömmlichen Geschlechtergrenzen in der Gesellschaft überschreiten – sei es, weil sie sich mit beiden binären Geschlechtern identifizieren, sich ganz außerhalb der binären Geschlechternorm verorten oder die Bezeichnung „transsexuell“ bzw. die Kategorie „Geschlecht“ für ihre Selbstdefinition ablehnen. Transgender bezieht sich im Unterschied zu transsexuell eher auf das soziale Geschlecht (Gender) und nicht-körperliche Geschlechterüberschreitungen. Der Begriff hat seine Ursprünge im politisch-aktivistischen Kontext und soll Menschen sichtbar machen, die von den herrschenden Geschlechternomen unterdrückt und stigmatisiert werden. Ebenso findet er Verwendung, um gegen die fremdbestimmte und patholigisierende medizinische Terminologie aufzubegehren und ihr eine eigene und positive Selbstbezeichnung entgegenzusetzen. Der Begriff „transgender“ wird in seiner Funktion als Oberbegriff von manchen transsexuellen Menschen wegen seines Fokus auf das Nicht-Körperliche kritisiert, da die Gefahr bestünde, zur Unsichtbarkeit von Transsexualität als körperliche Erfahrung beizutragen.
Transsexus
Bei manchen Menschen entsprechen die Körpermerkmale nicht dem Geschlechts (körper) bewusstsein. Es kommt vor, dass Menschen mit einem Penis geboren werden und weiblich sind. Oder männliche Personen werden mit einer Vagina geboren. Oder es werden nicht-binäre Personen geboren, die irgendwann verstehen: Meine Vagina gehört zu mir, aber Brüste dürfte ich nicht haben, so bin ich nicht „richtig“. Diese Menschen haben einen Transsexus – Körpermerkmale und Geschlechtsbewusstsein sind „nicht auf derselben Seite“ (lat. Trans).
Dieser Widerspruch zwischen Körpermerkmalen und Geschlechtsbewusstsein führt oft zu einem hohen psychischen Leidensdruck (Körperdypshorie). Daher steht für viele Menschen mit einem Transsexus die Auflösung dieses Widerspruchs im Vordergrund. Dies geschieht durch Hormoneinnahmen und körperangleichende Operationen. Außerdem erfolgt eine Änderung des Namens und des Geschlechtseintrags.
Ob ein Mensch mit Transsexus alle, einige oder auch keine körperlichen Angleichungen anstrebt, ist ausschließlich seine Entscheidung.
Wenn das Geschlechtsbewusstsein weiblich oder männlich ist, nennt man dies einen binären Transsexus (Transsexualität/Transgeschlechtlichkeit, engl. binary transgender). Ist das Geschlechtsbewusstsein weder männlich noch weiblich, so spricht man von einem nicht-binären Transsexus (Nicht-binäre, engl. Non binary transgender, Enby).
Transition / Transitioning
Als „Transition“ (lat. „transitio“ – Übergang) bezeichnet man den Prozess und Zeitraum, in welchem Menschen, die sich mit dem nach der Geburt anhand der Genitalien zugewiesen Geschlecht nicht oder nicht ausreichend beschrieben wissen, ihre Körpermerkmale, ihr Erscheinungsbild und/oder das juristische Geschlecht (Personenstand) an das tatsächliche Geschlecht anpassen.
Man unterscheidet zwischen der medizinischen, der gesellschaftlichen und der juristischen Transition.
medizinische Transition
beschreibt alle medizinischen Maßnahmen, die Menschen vornehmen können, um ihre körperlichen Merkmale an das eigene Geschlechtsbewusstsein anzupassen. Hierzu zählen z. B. Hormontherapien und/oder körperangleichende Operationen. Manche Anteile der medizinischen Transition, zum Beispiel eine Hormontherapie, können eine lebenslange Behandlung bedeuten. Hier gibt es also keinen „Endpunkt“, so wie es der Begriff Transition andeutet.
juristische Transition
beschreibt den Prozess der gesetzlichen Namens- und Personenstandsänderung. Dieser Prozess kann inklusive psychologischen Gutachten und Gerichtsentscheidung mehrere Monate bis Jahre dauern.
gesellschaftliche Transition
beschreibt den sozialen Prozess, der das offene Ausleben des tatsächlichen Geschlechts betrifft. Die soziale Transition beginnt oft mit einem Coming-Out in Freundeskreis, Familie und Arbeitsplatz. Es folgen zumeist Anpassungen von Kleidungsstil, Ausdruck und Stimme. Siehe auch „Passing“.
Wichtig: Es gibt nicht „die Transition“. Jede Person entscheidet für sich selbst, ob, wie, wann und in welchem Umfang sie transitieren möchte.